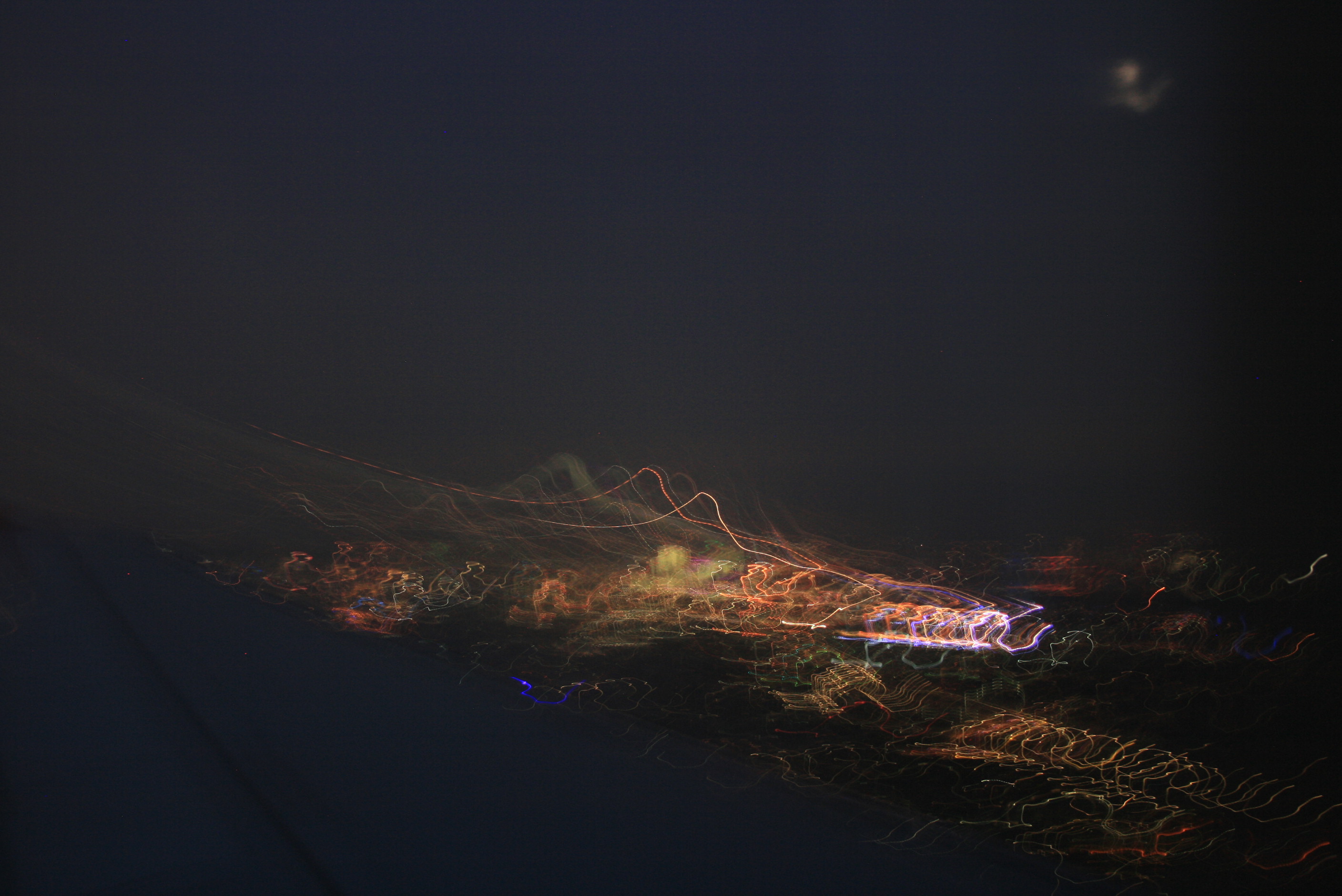Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir einen schönen Advent.

Schnee wie Lametta
wenn das Spinnengeweb hält
zart zwischen Zweigen

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir einen schönen Advent.

Schnee wie Lametta
wenn das Spinnengeweb hält
zart zwischen Zweigen


Foto: sibyll j. maschler >Am Maar / Eifel<

Sehnsuchts- und Seminarorte
Wer kennt sie nicht, die Orte der Sehnsucht? Ich fand einen auf Usedom, vor mehr als einem Jahrzehnt, am Achterwasser, fern des Tourismus. Dort wollte ich hin, leben, ab 2018 mit Plänen, im Folgejahr mit mehrwöchiger Probearbeit im Traumjob. Ein karger Lohn wäre in Ordnung gewesen, weil eben am Sehnsuchtsort selbst. Aber eine Arbeitszeit von April bis Oktober auf 6 Werktage verteilt und am 7. Tag in Bereitschaft zu sein, das wollte ich nicht, das konnte ich nicht. So blieb ich, wo ich war, wo ich immer noch bin.
Zu einem anderen Sehnsuchtsort habe ich Euch mitgenommen ->ins alte Rittergut Jahnishausen – mit Schloss und Remise, mutigen, gütigen Menschen, an einen weiten, grünen Platz und die große Feuerstätte, dorthin, wo der Ginkgo steht seit 200 Jahren, der Holunder blüht, Schlehen und Zwetschgen reifen am Ackerland.
Nun gibt es einen weiteren Sehnsuchtsort, versteckt und fast verwunschen, südlich des Haffs. Kennt jemand den Skulpturengarten zwischen Ueckermünde und Eggesin? Inmitten einer leicht hügeligen, weiten Landschaft, Skulpturen um Skulpturen, aus Holz und Stein, figürliche ebenso wie abstrakte, dazu Malerei, Träume, geschaffen vom Ehepaar Bisby-Saludas. Thorsten Bisby bietet im Sommer auch Bildhauerkurse an. Unter anderem deshalb gibt es dort acht Doppelzimmer, fünf Duschen und eine geräumige Wohnküche im offenen Atelier. Der Künstler heißt uns willkommen, uns, die Schreibenden, Lesenden, Kunstinteressierten und routinierten Selbstversorger.
Nach Rücksprache mit dem Vorstand, habe ich das letzte Augustwochenende 2023 für unser Seminar reservieren können.
Ja, es ist eine längere Anreise, die von uns gut koordiniert werden sollte. Vielleicht könnten unsere fernab lebenden Vereinsmitglieder vor- oder nach dem Seminar in Meck. Pomm. einen Urlaub planen. Da hätte ich sogar eine erprobte, ausgezeichnete Empfehlung. Bei Bedarf einfach bei mir melden. Soviel in Kürze. Ich bürge für den Charme des Ortes, die Inspiration der Landschaft und die Herzlichkeit des interessanten Gastgebers.
Termin vorgemerkt? Prima.
Zunächst wünsche ich Euch schöne Osterfeiertage!
sibyll jeanne


Foto: sibyll jeanne maschler

Teleskopisch
habe ich sie gesehen
die Ränder des Mondes
Krater voll Sonne
an Ostern
von senfgelb bis elefantengrau
schattiert und gegenüber
das Dunkel des Alls
fern der Erde wachend
Lilith Weib und Göttin
dazwischen lustvoll
Priapus der Erde nahe
wohin ihr Wesen des Mondes
auf dieser Welt
wohin
… in Vorbereitung des Seminars

„Alles, was man nicht kaufen kann“
Liebe Poeten
bringt Einfälle und Ideen zu diesem Motto mit in die Runde. Poetische Entdeckungsreisen führen oft in nichtkäufliche Regionen. Da könnten sich zum Beispiel zwei nicht käufliche Wesen treffen: „die Sehnsucht begegnet der Einsamkeit“.
Auch Glück und Pech kann man niemals vollständig mit Euros, Rubel oder Dollarscheinen einlösen. So gesehen sind die, welche weniger besitzen, mit denen, die glauben, alles zu haben, auf Augenhöhe.
Konfliktstoffe und poetische Ideen könnten im „Nichtkäuflichen“ schlummern.
Also laßt uns Nichtkäufliches sammeln und zusammentragen, was unserer Meinung nach dazu gehören kann.
Jeder ist aufgefordert, dazu im Seminar einen Vorschlag zu machen. Unkäufliches aus eigener Sicht…toll auch, wenn dazu Gedichte kämen. Es könnte der eigenen Feder entspringen, es könnte aber auch von Goethe oder M. Kaleko stammen. Hintergrund der Idee ist, Schreibfreude anzuregen und Stimmungen einzufangen. Laßt uns auf die Suche nach dem Unbezahlbaren gehen….
Gerhard Jaeger

Sie fuhr los, seit nunmehr einem Jahrzehnt immer wieder mit demselben Ziel. Unterwegs fragte sie sich, in welches Zimmerchen sie wohl dieses Mal einziehen wird. Würde sie eine Woche im Haupthaus, Seitenflügel oder in der nahegelegenen Baracke wohnen? Nun, die Zimmer sind eigentlich sowieso alle gleich: Ein schmales Bett, ein schlichter Schrank, ein Waschbecken, auf dem kleinen Schreibtisch ein Teelicht, darüber ein schnörkelloses Holzkreuz. Die Ausblicke unterscheiden sich dagegen erheblich. Eher wenig anmutend, ist der Blick auf den Parkplatz. Das Nachbargrundstück sieht gewöhnlich aus. Die Aussicht auf den Klostergarten ist dagegen wundervoll. Eine großflächige, leicht hügelige Wiese, alte Baumgruppen, gepflegte Hecken, geschützt gelegen Bänke ebenso wie freistehende, fast mittig ein künstlich angelegter, kleiner Brunnen aus Feldsteinen, daneben ein Ginsterstrauch. Dieser war erst in den letzten Jahren gepflanzt worden. Der Pater hatte einst den Bezug auf das Buch Jeremia erwähnt. Nach einer Stunde Fahrt endlich Ankunft. Dann Einzug ins Zimmer, dieses Mal über der Sakristei. Hier hatte sie noch nie gewohnt. Es war unerwartet. Auch, dass es ihr so vorkam, als würde sie Gott bereits hören, gleich vier Mal, sehr leise, von unten, irgendwie auch im gesamten Raum, aber besonders durch den Fußboden. Und sehr gleichmäßig. Später auch durch das Kopfkissen und die Matratze, bis Mitternacht immer öfter. Dann schlief sie ein, aber keinesfalls durch. Gott weckte sie, hielt sie wach. Dann fast Furcht vor dem Einschlafen, denn das Aufwecken störte wiederholt. Als es langsam hell wurde, endlich, der erwartete Klang der Klarinette. Sie hörte, dass ringsum einige Türschlösser bewegt wurden. Auch sie stand auf, öffnete die Tür einen kleinen Spalt und legte sich noch einmal ins Bett. Vertraute Klänge in all den Jahren, wiederkehrende. In der Stille des Hauses sehr einprägsam, wohlig. Sie wusste, dass es der Pater war. Immer, wenn Exerzitien waren, weckte er die Teilnehmenden zu früher Stunde. Dann Aufstehen und ins Gemeinschaftsbad. Dort hörte sie Gott nicht. Auch nicht im Speisesaal. In der Andacht vernahm sie Gott auf andere Weise. Der Pater las. Gott kommt nicht im Sturm, auch nicht im Erdbeben. Gott erscheint im sanften, leisen Säuseln. Da ist er hörbar. Da also auch, denkt sie. Dem Pater kann sie vertrauen. Schon von Anbeginn. Immer. Eine Freude auch, wenn er seinen Gästen mal die Tür aufhält. Mit gesenktem Blick macht er das, aber nicht aus Scham, sondern weil er des Dankes nicht bedarf. Sie kann in diesem Kloster alles annehmen. Im Gebäude atmet sie Gott. Auf dem Gelände auch. Und weit darüber hinaus. Sie lauscht. Ihr Klavierlehrer hatte einmal gesagt: Gehen sie mit den Ohren spazieren. Und nun im angrenzenden Wald. Unter den Schuhen Laub, Moos, Erde, kleine Stöckchen, Tannenzapfen. Knistern und Knacken in der Nähe und in der Ferne. Wie zwischen Gott und ihr. Manchmal knistert es und manchmal knackt es. Junge Bäume biegen sich im Wind, alte Bäume halten Stand oder bersten. Sie atmet frische Luft. Oben, in den Wipfeln, Lichtfenster. Himmelwärts. Sie geht zurück. Und erwartet das Läuten. Glocken rufen in den Wald, über die Dächer, in die Straßen: Kommt! Es sind alle geladen. Sie hat Hunger. An den Tischen kaum Blicke, mehr Gesten und das Klappern des Bestecks auf den Tellern. Leise Musik gegen die Geräusche des Kauens. Danach klopft Gott wieder, einmal, zweimal. Taktvoll. Der Klang etwas rund, wie kurz angeschoben, sich öffnend, aber rasch wieder abnehmend, kugelförmig, scheinbar angestubst, den Raum mild umlaufend, durchlaufend, leise. Dabei will sie doch eigentlich ruhen. Es gelingt ihr nicht. Gott ruft. Die Tage vergehen. Gott bringt sich regelmäßig in Erinnerung, durchdringt, kehrt wieder, mal mehr, mal weniger. Wenn sie geht, draußen zum Beispiel, kann sie Gedanken auf Wolken setzen. Oder Zugvögeln mitgeben. So wird ihr Kopf frei. Wenn sie Mut hat, zum Unplanbaren, kommen neue Gedanken, ohne Einladung. Dann können neue Erfahrungen folgen. Wenn die Geräusche des Tages abnehmen, wird Gott lauter. Wenn er dann anklopft, der Regulator in der Sakristei, kann das nerven. Aber eigentlich tut er gut. Ohne ihn, wieder zu Hause, kann Göttliches allzu schnell verloren gehen. Doch ruft er sie, aus dem Alltagsrad, dem Gedankenkarussell heraus und führt zurück, auf das Wesentliche, dann beginnt Heilung. Bei ihr zumindest. sibyll jean maschler
Spät, aber herzlich, möchte ich einen kurzen Gruß zum Neuen Jahr senden.
Hoffentlich hattet Ihr sowohl gesunde als auch besinnliche und glückliche Feiertage. Wie werdet Ihr sie verbracht haben? Kann ich die eine oder den anderen für einen Kommentar auf unserem Blog gewinnen, hörte ich doch von einem Besuch auf entlegener Insel und anderen bewegenden Ereignissen. War Eure Feierlaune vielleicht durch das Verkaufsverbot von Pyrotechnik beeinträchtigt oder habt Ihr Euch mehr darüber gefreut, weil Ihr die Tiere weniger verängstigt wusstet und die Luft weniger belastet? Bei uns war es kaum ruhiger als sonst, lediglich das Höhenfeuerwerk vom Filmpark blieb aus. Inzwischen ist auch der Steckweihnachtsbaum demontiert und somit `Tanne von gestern‘. Der wiederverwendbare Koniferenstamm fand im schuppen Platz und die Zweige haben sich in der Feuerschale zu knisternder Wärme verwandelt. Husch, schon war der Zauber vorbei und verflogen. So ist das ja manchmal im Leben.
Bloß das eine Thema, sagen wir, das C-Thema, will sich einfach nicht verdünnisieren. Vielleicht birgt das noch junge Jahr die Chance, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, damit wir nicht weiter auseinander driften, sondern tragbare Lösungen entwickeln können.
Abschließend möchte ich einladen, Andreas in den ungeraden Monaten und mir in den geraden Monaten, Texte zu mailen, damit der Blog, nach dem noch anhaltenden Winter, wieder zarte Knospen hervorbringen wird.
Es grüßt sibyll


Als hätt‘ der Sternwind ihn geschickt den Sternenstaub auf diese Welt herüber weht er fällt nun sanft ein Silberglanz bleibt auf dem Haar die Wege füllend ebnen sich zu meinen Füßen Wölkchen jetzt mein Sternenstaub auch wirbelnd Licht im Herz‘ und deinem Angesicht sibyll j. maschler 2021

sibyll maschler Foto: B.M.T.
Liebe sibyll,
ich bedanke mich bei Dir für die nun schon neun Jahre andauernde gute Zusammenarbeit für unseren Blog.
Besonders angenehm für mich war festzustellen, dass Du kontinuierlich über die Jahre hinweg die Entwicklung im Blog verfolgt hast und von Dir aus Texte und Fotos zur Verfügung gestellt hast. Hab Dank dafür.
Die Hervorhebung Deiner Beiträge sind eine Hommage an Dich, verbunden mit allen guten Wünschen für Dein persönliches Wohlergehen.
Liane Fehler Onlineredaktion
Im Slider (ganz oben im Blog) werden in den nächsten Tagen Beiträge von sibyll maschler präsentiert.
Nicht nur Texte sondern auch viele Fotos von sibyll maschler sind in den letzten Jahren in unserem Blog veröffentlicht worden.